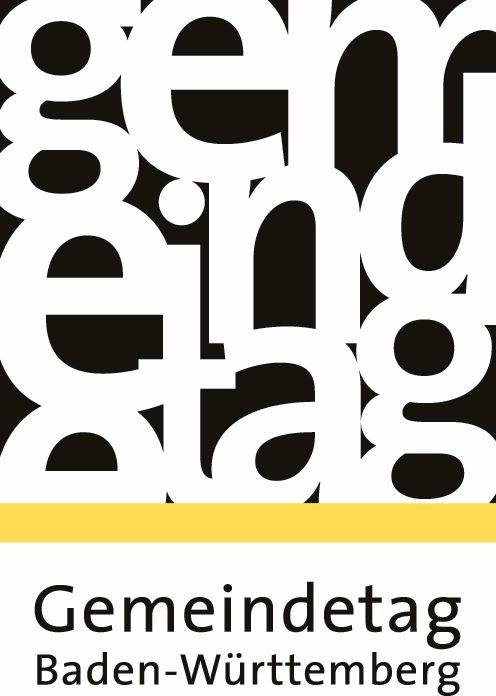Studie: So gelingt Mobilität im Ländlichen Raum
Dabei nahmen die Forscherinnen und Forscher sechs konkrete Projekte in Augenschein, die zuvor im Rahmen eines Ideenwettbewerbs entwickelt worden waren: Automatisierte Bürgershuttles in Künzelsau, ein Mobilitätskonzept in Pfalzgrafenweiler, ein Bürgerladenetz in Sigmaringen, ein Carsharing- und Lastenrad-Projekt in Renningen, ein Carsharing-Modell in Calw sowie ein Vereins-Shuttle in Oftersheim.
Erschwerende Rahmenbedingungen im Ländlichen Raum
Die Ausgangslage beschreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so: Der Ländliche Raum in Baden-Württemberg sei strukturell gut aufgestellt und könne sich mit den Ballungsräumen anderer Bundesländer messen. Doch es gibt spezifische Herausforderungen: Fehlendes Budget, Personalmangel und fehlende digitale Infrastrukturen erschweren unter anderem die Organisation, Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit relevanten Akteuren, schreiben die Autorinnen und Autoren der Studie.
Ländlicher Raum braucht maßgeschneiderte Konzepte
Als Schlüssel zum Erfolg haben die Forschenden die Zusammenarbeit von Kommunen identifiziert. Das gilt freilich nicht nur für die Mobilität − in einer weiteren Studie hat das selbe Institut in der vergangenen Woche betont, dass auch bei Smart-City-Projekten diese Regel gelte. Bei der Mobilität im Ländlichen Raum gilt sie allerdings im besonderen Maße. Der Ländliche Raum brauche maßgeschneiderte passgenaue Mobilitätskonzepte, die sich dadurch auszeichnen würden, dass sie langfristig die Bedürfnisse der nachfrageschwachen Regionen befriedigen und gleichzeitig die Lebensqualität dadurch steigern, dass sie die Erreichbarkeit vor Ort verbessern, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Erfolg durch enge Kooperation zwischen Kommunen
Die Autorinnen und Autoren der Studie betonen, dass Kooperationen, die die Grenzen der Gemeinden überschreiten, auch zu Komplikationen und Verzögerungen führen könnten. Gerade deshalb sei eine besonders enge Abstimmung zwischen den Verantwortlichen geboten. Einen besonderen Fokus legt die Studie auf den Aspekt, dass Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern einbezogen wurden. Das Motiv ist nicht schwer zu erraten: Wird die Bürgerschaft von Beginn an aktiviert, steigt die Akzeptanz des jeweiligen Projekts. „Jede Gemeinde hat andere Bedürfnisse. Daher sind stabile und vertrauensvolle Partnerschaften und die Beteiligung regionaler Partner entscheidend für den erfolgreichen Aufbau eines kooperativen Mobilitätsangebots“, sagt Mitautorin Anne Spitzley.
Vier Adressaten für Handlungsempfehlungen
Die knapp 40 Seiten umfassende Studie, die Leserinnen und Leser hier abrufen können, geht detailliert auf die sechs Projekte ein und schildert, welche Herausforderungen es auf dem Weg zur Umsetzung gegeben hat. Am Relevantesten für Kommunen dürften aber die konkreten Handlungsempfehlungen sein. Diese haben die Autorinnen und Autoren für Mobilitätsanbieter, für zivilgesellschaftliche Organisationen, für Politiker − und auch für Kommunen herausgearbeitet. Letztere stellt die:gemeinde-Aktuell im Folgenden vor.
Handlungsempfehlungen für Kommunen
Die Handlungsempfehlungen werden den Kategorien „Rahmenbedingungen“, „Regionale Einbettung“, „Wirtschaftlichkeit“ und „Betreibermodelle“ sowie „Ökologische Effekte“ zugeordnet:
Rahmenbedingungen:
- Sei bereit in die Zukunft zu investieren
- Habe Mut für neue Mobilitätsangebote
- Beteilige Bürgerinnen und Bürger aktiv
- Unterschätze nie das Ehrenamt und integriere es, wo möglich
- Sorge für Austausch zwischen den Projektbeteiligten – oft reicht auch Austausch bei Bedarf
- Schaffe vertrauensvolle, langjährige Kooperationen
Regionale Einbettung:
- Bleib in der Region
- Schaffe Sichtbarkeit und steigere die Bekanntheit der Mobilitätslösungen in der Kommune
- Generiere Vertrauen in neue Mobilitätslösungen durch die Einbindung von regionalen Akteuren sowie lokalem Ehrenamt
- Nutze Multiplikatoreneffekte zur Erhöhung der Nutzung des Mobilitätsangebots
- Sorge für gemeinsame Werbung der verschiedenen Partnerinnen und Partner
Wirtschaftlichkeit und Betreibermodelle:
- Informiere dich und andere über Förderungen und nutze diese
- Sei bereit, ein wirtschaftliches Risiko einzugehen, wenn das Mobilitätsangebot Potenzial hat
- Schaffe neue Geschäftsmodelle und nachhaltige Lösungen durch die Kooperation verschiedener Akteure
- Frag die Profis
- Stelle notwendige Infrastrukturen bereit Nutzungsbedarfe und-akzeptanz
- Erhöhe die Nutzungsakzeptanz durch Bürgerbeteiligungsformate und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die potenzielle Nutzerinnen und Nutzer aktiv ansprechen und einbinden
- Generiere Vertrauen in neue Mobilitätslösungen durch die Einbindung von regionalen Akteuren sowie lokalem Ehrenamt
Ökologische Effekte:
- Berücksichtige positive ökologische Effekte bei Mobilitätskonzepten
- Fördere multimodales Verhalten und Nutzung des ÖPNV durch neue Mobilitätslösungen.